Jenseits des grünen Wasserstoffs
Wasserstofffarben sind eine praktische Kurzform, aber wir sollten genauer hinsehen.
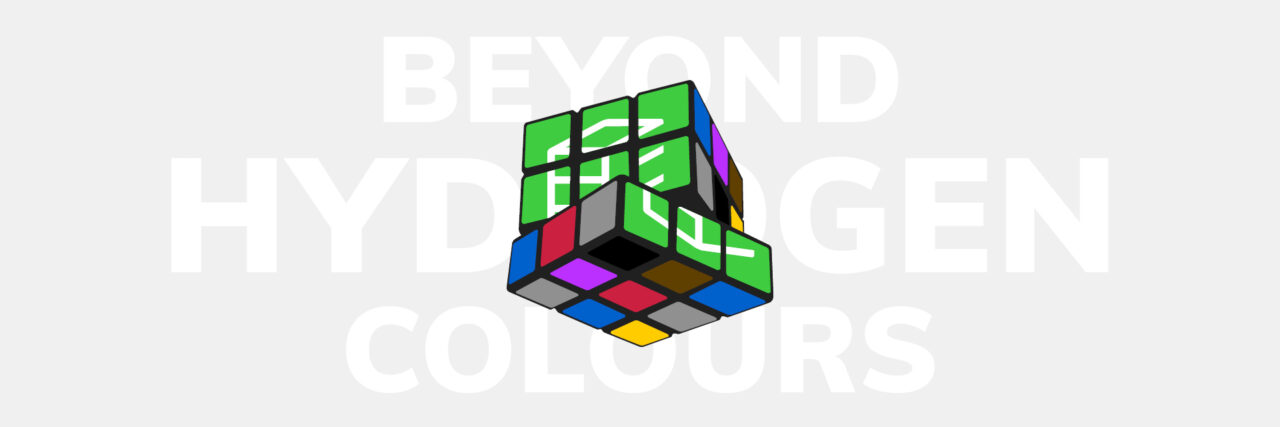
Mittlerweile ist es fast unmöglich, noch nie von den Wasserstofffarben gehört zu haben – einem Schlüsselcode von Wasserstofftönen, der uns Auskunft über die Energiequelle hinter einem bestimmten Wasserstoffgas gibt.
Die wichtigsten sind grüner, blauer und grauer Wasserstoff, aber es gibt noch mehr, wenn man tiefer in die Materie einsteigen möchte.
Es setzt sich aber auch immer mehr die Erkenntnis durch, dass innerhalb jeder Farbe – zum Beispiel beim grünen Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien und Wasser hergestellt wird – nicht alles gleich ist.
Wie hoch ist zum Beispiel die Kohlenstoffintensität von grünem Wasserstoff, der von verschiedenen Parteien mit unterschiedlichen Elektrolyseuren und verschiedenen Energiequellen hergestellt wird?
Und was ebenso wichtig ist: Wenn behauptet wird, dass blauer Wasserstoff ein „kohlenstoffarmer“ Wasserstoff ist, wie können wir dies untersuchen, um seinen Fußabdruck sinnvoll mit dem von grünem Wasserstoff zu vergleichen?
Was ist grün?
Derartige Fragen werden weltweit zunehmend untersucht, da an der Ausarbeitung nationaler, regionaler und internationaler Normen, Zertifizierungen und Definitionen für grünen Wasserstoff gearbeitet wird.
Zu nennen sind hier vor allem der European Union’s Delegated Act zur Definition von „erneuerbarem Wasserstoff“ sowie das im Entstehen begriffene Gegenstück in den USA, aber auch Vorschläge für internationale Normen von Gruppen wie der Green Hydrogen Organisation und der International Partnership for Fuel Cells and Hydrogen in the Economy (IPHE).
Abgesehen von der möglichen Problematik mehrerer konkurrierender Normen ist dies eine wichtige Arbeit.
Und warum? Nehmen wir ein theoretisches Beispiel: Ein Elektrolyseur, der vor Ort mit erneuerbaren Energien hergestellt wurde, wird ausschließlich mit überschüssigem Solarstrom aus nahe gelegenen PV-Modulen betrieben, während ein importierter Elektrolyseur, der mit Strom aus fossilen Brennstoffen hergestellt wurde, mit Strom aus dem Netz betrieben wird, der als erneuerbar zertifiziert ist.
Letzterer hat zwar eine viel höhere Kohlenstoffintensität, doch ist dies ohne Normen, die die zulässigen Grenzwerte für den verkörperten Kohlenstoff festlegen, wenn Wasserstoff als umweltfreundlich bezeichnet wird, und ohne die Energiequelle, die für seine Herstellung verwendet werden darf, schwer zu erkennen.
Der letzte Punkt ist wichtig, da Analysten davon ausgehen, dass ein Elektrolyseur, der Wasserstoff ausschließlich aus Netzstrom erzeugt, einen viel schlechteren Kohlenstoff-Fußabdruck haben kann als die Produktion von grauem Wasserstoff.
Wie sauber ist „kohlenstoffarmer“ Wasserstoff?
Das führt uns zu einer weiteren Frage. Andere Bezeichnungen wie „kohlenstoffarmer“ oder „sauberer“ Wasserstoff werden in dem Bemühen verwendet, den blauen Wasserstoff in das Pantheon der Dekarbonisierungslösungen aufzunehmen.
Die Bezeichnungen geben nicht viel Aufschluss. Von wie viel Kohlenstoff ist hier die Rede, da die Quelle dieses Wasserstoffs fossile Brennstoffe sind?
Blauer Wasserstoff wird hauptsächlich aus Erdgas durch ein Verfahren namens Dampfreformierung hergestellt. Das bei dieser Produktion entstehende Kohlendioxid kann technisch aufgefangen und durch Projekte zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture, Utilisation and Storage - CCUS) gespeichert werden.
Das Problem ist, dass, selbst wenn CCUS auf die Abscheidung von 90-95% der Emissionen abzielt – und bei den bisherigen Versuchen wurde manchmal nicht einmal die Hälfte davon erreicht –, der beste blaue Wasserstoff eine viel höhere Kohlenstoffintensität hat als grünes H2 und daher möglicherweise nicht zur Dekarbonisierung beiträgt.
Daher sehen viele, darunter auch Enapter, darin keine echte Lösung für das Klima, nicht einmal in der Zwischenzeit. Wir müssen uns den tatsächlichen Kohlenstoff-Fußabdruck ansehen, nicht den Hype, und dementsprechend Standards setzen.
Unser Ansatz
Während wir die Festlegung von Normen zur Lösung der oben genannten Probleme unterstützen – und mit den Herstellern in Kontakt stehen – liegt unser persönlicher Schwerpunkt auf der Herstellung der bestmöglichen Elektrolyseure bei gleichzeitiger Minimierung ihrer Umweltauswirkungen.
Wir verfolgen dabei das Ziel einer industriellen Produktion mit null negativen Auswirkungen: Life Cycle Impact Zero. Dabei geht es nicht nur um die CO2-Emissionen, aber das spielt eine große und übergreifende Rolle.
Unser neuer Elektrolyseur EL 4.0 wurde beispielsweise mit Blick auf die Wiederverwertbarkeit und eine kontinuierliche Optimierung entwickelt. Dieser Ansatz der Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, Abfall und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, indem der Einsatz von Rohstoffen verringert wird.
Enapter hat bereits den Kohlenstoff-Fußabdruck seines Elektrolyseurs EL 2.1 berechnet und wir untersuchen mit unserem Projekt Life Cycle Impact Zero, wie wir die negativen Auswirkungen reduzieren können.
Unser Produktions- und F&E-Standort Enapter Campus in Saerbeck, Deutschland, wird zu 100 % mit lokal erzeugter erneuerbarer Energie betrieben – einschließlich Solaranlagen auf dem Dach.
Wir haben eine ganze Reihe von Ideen, wie wir die Kohlenstoffintensität des mit unseren AEM-Elektrolyseuren erzeugten grünen Wasserstoffs weiter reduzieren können – und wir setzen sie bereits in die Tat um.
And while the term “renewable hydrogen” may better reflect the need to only use renewable energy sources, we’ll also continue to use the term “green hydrogen” as it’s commonly understood shorthand to communicate the fact that only one form of H2 can be sustainable.
Aber es ist an der Zeit, dass die Diskussion über die Farben hinausgeht und sich auf die wahren Auswirkungen von Wasserstoff konzentriert.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns in den sozialen Medien, um die Diskussion fortzusetzen.